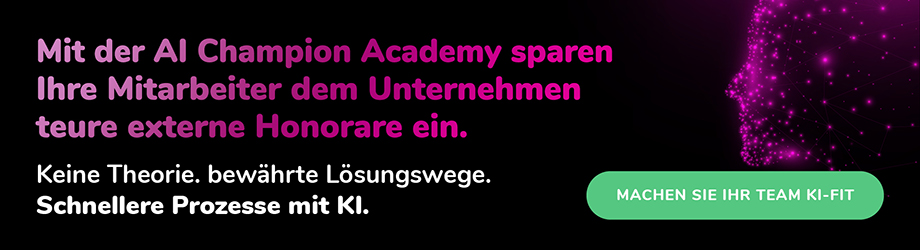Im Rahmen des EVOPLAST-Projekts kooperieren SKZ, ZBT Duisburg und sechs Industriepartner, um polymere Werkstoffe gezielt für PEM-Brennstoffzellen zu validieren. Durch innovative In-situ-Prüfverfahren und detaillierte GC/MS-Analysen wurden materialspezifische Emissionsprofile erstellt und medienresistente, hochreine sowie dauerhafte Kunststoffe identifiziert. Diese Erkenntnisse ermöglichen gezielte Materialauswahl, reduzieren Kosten und Gewicht und fördern die Zuverlässigkeit in mobilen und stationären Brennstoffzellensystemen. Das Projekt stärkt gleichzeitig industrielle Netzwerke entlang der Wertschöpfungskette und beschleunigt effektiv die Markteinführung nachhaltiger Brennstoffzellentechnologien.
Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel
Industriepartner AGC, Bürkert, ContiTech und Mitsui prüfen systematisch Polymerbeständigkeit
Zwischen Mai 2023 und April 2025 setzten das SKZ und das ZBT im Industrieprojekt EVOPLAST gemeinsam mit fünf Industriepartnern – AGC Chemicals Europe, Bürkert Fluid Control Systems, ContiTech Deutschland, Mitsui Chemicals Europe sowie Treffert GmbH & Co. KG – neue Bewertungsmethoden um. Dabei wurden spezifische Prüfverfahren für Polymerwerkstoffe in PEM-Brennstoffzellen etabliert, um ihre Beständigkeit gegen Betriebsmedien, die Reinheit der Werkstoffe und ihr Langzeitverhalten unter realen Einsatzbedingungen fundiert zu analysieren und zu optimieren.
Wasserstoff und PEM-Zellen liefern emissionsfreie Mobilität und stationäre Erzeugung
PEM-Brennstoffzellen, die mit Wasserstoff betrieben werden, erreichen Wirkungsgrade von über 60 Prozent und arbeiten emissionsfrei vor Ort. Sie passen flexibel zu Photovoltaik- und Windkraftanlagen, indem sie überschüssigen Strom in chemische Energie umwandeln. Im Verkehrssektor ermöglichen sie große Reichweiten und kurze Tankzeiten in Pkw, Bussen, Zügen und Schiffen. Für Lkw und Nutzfahrzeuge gleichen sie Gewichtsnachteile aus. Stationär liefern sie autarke Strom- und Wärmeversorgung sowie Notstrom in Gebäuden bei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit.
Innovatives ZBT-Sensorsystem bewertet direkt Additiv-Emissionen in Brennstoffzellenanode und Kathodenzuleitung
Im Rahmen einer eigens entwickelten In-situ-Prüftechnik werden Kunststoffmuster gezielt im Anoden- beziehungsweise Kathodenzulauf einer PEM-Brennstoffzelle positioniert. Anschließend gelangen die während der Betriebsbedingungen freiwerdenden organischen Emissionen in ein angeschlossenes Sensorsystem. Dort erfolgen kontinuierliche Messungen von Spannungseinbrüchen und Leistungsveränderungen, um den Einfluss chemischer Zusatzstoffe direkt zu erfassen. Die Echtzeitanalyse ermöglicht eine belastbare Abschätzung zur Stabilität und Reinheit polymerer Werkstoffkomponenten, wodurch gezielte Optimierungsstrategien für Formulierungen abgeleitet werden können und so die Langzeitperformance steigt.
Gaschromatographie und Massenspektrometrie ermöglichen Identifikation und Quantifizierung emittierter Substanzen
Parallel zur In-situ-Prüfung erfolgten systematische Ex-situ-Analysen mittels Gaschromatographie und Massenspektrometrie, um die freigesetzten Moleküle umfassend zu charakterisieren. Spezifische Substanzklassen wurden identifiziert, und deren quantitative Konzentrationsprofile wurden ermittelt. Darauf aufbauend entstand ein standardisiertes Prüfverfahren, welches die Auswahl von Kunststoffen für PEM-Brennstoffzellen nach einheitlichen Kriterien steuert. Die Validierung des Protokolls erfolgte unter praxisnahen Bedingungen. Dieses Prüfverfahren ermöglicht Vergleichbarkeit, fördert Materialoptimierung und reduziert Kosten sowie Gewicht in unterschiedlichen Einsatzfällen und steigert die Systemzuverlässigkeit.
Spannungsverluste von null bis fünfzig Prozent offenbaren gravierende Materialdefizite
Die durchgeführten Analyseverfahren offenbarten ein äußerst uneinheitliches Emissionsverhalten von Kunststoffen mit identischer Grundstruktur, das Spannungsverluste von null bis fünfzig Prozent bewirkte und in manchen Fällen innerhalb weniger Stunden zum kompletten Leistungsabfall führte. Bereits geringste Anteile an Additiven oder Füllstoffen hatten erheblichen Einfluss auf die Degradationsdynamik. Als Folge passten die beteiligten Industriepartner ihre Rezepturen und thermischen Vorbehandlungsschritte gezielt an, um Emissionen zu minimieren und die Langzeitstabilität der Brennstoffzellen erheblich zu steigern.
Neues IGF-Folgeprojekt adressiert jetzt werkstofftechnische und systemrelevante Fragestellungen gemeinsam
Auf Basis der vorherigen Studien planen SKZ und ZBT ein weiterführendes IGF-Folgeprojekt, um detaillierte Feststoffanalysen, Materialkompatibilitätstests und systemtechnische Bewertungen in Brennstoffzellsystemen durchzuführen. Ziel ist es, kritische Einflussfaktoren on-site zu erfassen, Prototypen unter realistischen Betriebsbedingungen zu erproben und datenbasierte Optimierungsstrategien zu entwickeln. Potenzielle Partnerunternehmen können sich dem begleitenden Ausschuss anschließen, ihre Kompetenzen einbringen und gemeinsam modulare Konzepte für eine effiziente und robuste nächste Generation von PEM-Brennstoffzellen zu gestalten. Unter strikten Industriestandards.
Kombinierte In-situ- und Ex-situ-Analysen reduzieren Kosten Gewicht steigern Zuverlässigkeit
Die Kombination aus In-situ- und Ex-situ-Analysen im EVOPLAST-Projekt schafft eine belastbare Grundlage für die gezielte Auswahl polymerer Komponenten in PEM-Brennstoffzellen. Durch detaillierte Emissions- und Leistungsbewertungen lassen sich Materialkosten und Gewicht deutlich reduzieren, während die Langzeitzuverlässigkeit der Systeme steigt. Standardisierte Testprotokolle beschleunigen die Entwicklung und Validierung neuer Werkstoffrezepturen. Dies unterstützt die rasche Markteinführung effizienter Brennstoffzellentechnologien in mobilen und stationären Anwendungen und fördert die Energiewende und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.